Ich öffne die Augen und erschrecke. Etwa zweieinhalb Meter vor mir durchdringt ein rot strahlendes LED-Lämpchen die stockfinstere Lodge. Links über mir, an der Decke, ein zweites. Grün. Schwächer. Aber größer. Mir ist sofort klar — Kameras. Ich bewege mich nicht. Bleibe still liegen. Versuche zu verstehen. Mein Herz beginnt härter zu schlagen. Ich halte die Luft an. Atme langsam und leise wieder aus. Flach. Nur nicht die Kameras auslösen. Denke ich.
Draußen tobt ein Sturm. Der Regen prasselt auf die Autodächer, die im Hof des Motels geparkt sind. Ich greife nach meinem Telefon. Taste im Dunkeln. Finde nur den Reiseführer. Würde gleich das Wasser in unsere Lodge vordringen? Unter der Tür hindurch? Würden gleich die Sirenen der Firefighters ertönen? Schreie? Panik? Würden wir gleich evakuiert werden? Ich entschlummere. Unbemerkt.
„Guten Morgen!”, sage ich und fühle nach, wie es dem ungeborenen Leben geht. Ich stehe auf und schiebe den Vorhang beiseite. Der Pazifik ist aufgeregt. Schäumt vor Wut. Er trommelt mit Wellen auf seinem Brustkorb herum. Unermüdlich. Gischt. Nebel. Und der Himmel? Ist nicht zu sehen. Aber er schickt dicke Tropfen auf die Erde. Will dem Pazifik in nichts nachstehen. Und ich denke: „Regen kann einem Ozean nichts anhaben!“ Ich schmunzele. Öffne die Tür. Trete hinaus. Runzele die Stirn. Etwas ist komisch. „Feuer bekämpft man in seiner höchsten Kunst doch auch mit Feuer!“ Es regnet aus Kübeln, ist aber aber so gut wie windstill.
„No more drought. Yihaa!“
Eine große Fensterfront gibt die Sicht auf den Ozean frei. Das Feuer im Kamin flackert. Knistert beruhigend. Als wolle es die Fehde zwischen Himmel und Pazifik besänftigen. Die Concierge möchte nächstes Jahr Heidelberg besuchen. Sie lernt deutsch. „Guten Abend“, sagt sie. Ich antworte amüsiert: „Uh, good morning. Heidelberg is special. Really beautiful. You’ll like it!“ Ich bin noch nie in Heidelberg gewesen. Die gekochten Eier sind kalt und hart. Sehr hart. Sie zerbröseln auf dem Brot. Es gibt keine Butter, die es eventuell halten könnte. Der Filterkaffee ist gut. Es gibt Mandelmilch. Wie selbstverständlich. Weil in Kalifornien sehr viele Mandeln angebaut werden. Neben Spanien ist der Mandelanbau nirgendwo anders auf der Welt so verbreitet wie in Kalifornien. Dafür wird in einem Jahr mehr Wasser benötigt, als es Los Angeles mit all seinen Beverly-Hills-Bewohnern tut. Das ist heute aber egal, denn es regnet. Und ein Blick in die Medien bestätigt es. Der Gouverneur von Kalifornien erklärt die Dürre für beendet. No more drought. Yihaa! Viele Kalifornier sehen diese Feststellung etwas differenzierter. Aber das ist ein anderes Thema.
Es regnet also. Und es sieht nicht so aus, als würde es so schnell wieder aufhören. Wir sitzen im Auto und biegen auf den Cabrillo Highway. Er trennt die saftig grünen Hügel vom Pazifik. Beim ersten Blick auf die Küste war ich durchaus überrascht. Ich hatte sie mir rauher vorgestellt. Wilder. Auf den zweiten Blick wirkt sie gar lieblich. Und ich überlege mir, wie das zusammen passt. Vielleicht ist der Pazifik ruhiger geworden. Im Gefühl des sicheren Siegers im Kampf gegen das Festland. Er hat die schroffen Berge zu sanften und ewig runden Hügeln zurechtgeschliffen. Vielleicht. An einigen Stellen droht er dem Hinterland weiterhin. Er tritt über die Ufer auf den Highway. Hier weicht die Fahrbahn einfach auf. Zarghaft schlägt das Festland zurück. Hin und wieder. Indem es Erde, Steine und Geröll hinunterwirft. In die anlandenden Wellen. Mal garstig. Mal mild.
„Eine handgemachte Drohgebärde.“
Vorbei an den Seeelefanten. Die einfach Monate lang am Strand rumliegen. Sich sonnen und kratzen. Wenn sie im Winter im eiskalten Wasser schwimmen, vernachlässigen sie ihre peripheren Körperregionen. Bewußt. Sie halten hauptsächlich ihre Organe warm. So stirbt die Haut ab. Und diese muss nun runter. Schön zu sehen. Und irgendwie auch beruhigend. Heute liegen sie im Regen. Das scheint ihnen aber auch egal zu sein. Für sie gab es keine Dürre. Und ich überlege mir, ob sie vielleicht vom Pazifik geschickt wurden. Als Wächter auf dem Festland? Meine Fresse. Wir fahren weiter. Schnell vorbei an den süßen Seeottern, die in der Morro Bay lässig mit ihren Kids abhängen. Sonst komme ich noch auf die Idee, sie hätten auch irgendeine tragende Rolle in dem epischen Kampf zwischen Pazifik und kalifornischer Küste. So wie der lustige Hügel. Der Bucht vorgelagert. Er weist eine verblüffende Ähnlichkeit mit dem Zuckerhut auf. Jedenfalls denke ich das. Ich kenne den Zuckerhut ja lediglich von Bildern. Oder das Wasserkraftwerk rechterhand. Und ein wenig weiter südlich — der Atommeiler. Der steht da unmittelbar am Meeresufer. Wie sein Pendant in Fukushima. Ein Geschützturm gegen die Wassermassen. Eine handgemachte Drohgebärde. Häßlich. Grau. Vor schäumend blauem Wasser. Schönes Bild. Irgendwie.
In Pismo Beach verdichtet sich der Gedanke und verdunkelt sich der Tag. Genau wie man in Hamburg den Menschen an sonnenüberfluteten Sommertagen anmerkt, dass sie damit nicht souverän umgehen können, genauso merkt man den Kaliforniern in Pismo Beach an, dass sie mit Regen nicht umgehen können. Wie denn auch. Es hat seit 5 Jahren nicht mehr länger als 5 Minuten am Stück geregnet, erzählt uns die Inhaberin von Chipwrecked, wo wir lunchen. Am Morgen hätten sie alle auf der Straße getanzt. Im Regen. Das zeugt tatsächlich nicht von einem souveränen Umgang mit Niederschlag. Denke ich als Norddeutscher. Bremer. Wahl-Hamburger. Wie so oft, lege ich mir noch eine eigene Analogie zurecht. Zur Sicherheit. Falls die andere mal nicht stand hält – Anzug tragenden Männern sieht man auch an, ob das für Sie normal ist oder nicht! Zippeln sie am Kragen rum? An der Hose? Öffnen und schließen sie ständig das Jackett? Oder bewegen sie sich ganz normal darin? Bewegen sich sogar lässig? Ich meine, man kann es erkennen. Die selbstgemachten Potato-Chips sind lecker, das Sandwich auch. Ich gehe kurz hinaus. Die Parkuhr füttern. Es regnet in Strömen. Pitschnasse Hawaii-Hemden. Vom Regenaufprall vibrierende Palmenwedel. Sand befördernde Wasserströme am Straßenrand stürzen sich in die Kanalisation. Ich trete in eine Pfütze. Dann werfe ich 2 Dollar nach.
Wir entscheiden etwas. Wir geben auf. Wir gehen in die Spielhalle nebenan. Zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein. Das ist anderen vorbehalten. Seit jeher. Aber der Taifun-Tisch wird gerade frei. Und schon geht sie ab — die luftgepolsterte Post. Kaum jemand wird je von sich behaupten können, an einem der regnerischsten Tage innerhalb vieler Jahre, in Pismo Beach gewesen zu sein. Einem der beliebtesten Strände zwischen San Francisco und Los Angeles. Am Tag, als die Dürre endete. Wir schon.
„We go to Paso Robles via Los Osos Valley Road.“
„We go to Paso Robles via Los Osos Valley Road.“ Im Radio haben die Mariachis längst die nervenden amerikanischen Radiosender verdrängt. Und von Paso Robles geht wieder zurück nach Cambria. Und Cambria sieht heute wirklich aus wie Wales. Der Regen machts. Oder die lateinische Übersetzung. Es fehlen allerdings die Schafe. Wir haben Karten für ein Gartenkonzert gekauft. Es beginnt um 19 Uhr. Die gewohnte Unsicherheit gegenüber dem Wetter gibt uns fast ein heimisches Gefühl. Aber das lassen wir uns nicht anmerken.
Wir betreten das Restaurant Robin’s Garden. Kalifornische und asiatische Küche. Sehr lecker. Davon konnten wir uns bereits am Vorabend überzeugen. Die lustige Mischung der Einflüsse hat mit der Herkunft der Chefin zu tun. So interpretieren wir das jedenfalls. Wo die Liebe eben hinfällt. Ich erinnere mich an eine ebenso ungewöhnliche Mixtur. Ein Restaurant in der Oderberger Straße in Berlin. Es hatte damals gerade eröffnet — japanische und norddeutsche Küche stand da in großen Lettern gestürzt auf einer Fahne. Das hörte sich abgefahren an. Und der sonntägliche Zug über die Flohmärkte hatte uns hungrig gemacht. Luke und ich gingen hinein. Die Küche sei noch nicht warm. Teilte uns der Wirt und anscheinend Inhaber mit. Sichtlich bemüht, uns damit nicht zu verschrecken, bot er an, uns schnell ein Sashimi zu zaubern. Das sind rohe Fischfilets. Kalt. Wir waren die einzigen Gäste. Klar. Wir nahmen an. Und als wir die Etagere geleert hatten, fragte er uns interessiert, was uns uns am besten geschmeckt habe. Wir waren kurz aufgeschmissen. Die Frage setzte ja für eine korrekte Antwort durchaus voraus, jeden Fisch anhand seines Geschmackes und seiner Eigenschaften beim Namen nennen zu können. Doch unverhofft gewieft antworteten wir präzise unpräzise: „Der ganz oben drauf!“ Und bämm, die Antwort schien richtig gewesen zu sein. Ein Leuchten verwandelte seine Augen in frisches Sashimi. Sein Grinsen machte sein Gesicht zu einem Kugelfisch. Und seine befreienden Bewegungen glichen einer unbekannten asiatischen Kampfkunst. Er kam aus Kiel. Mit einem Ausfallschritt glitt er geschmeidig in die Hocke. Den rechten Fuß nach vorn. Seine weiße Kochjacke war plötzlich die eines Altmeisters. Mit seinem Zeigefinger deutete er zunächst auf Luke. Dann auf mich. Im breitesten norddeutschen Dialekt schoss es aus ihm hervor: „Ihr seid Gourmeeeeeets, Alter! Gourmeeeeets seid Ihr! Das ist Makrele! Aus der Nordsee. Gourmeeeeets seid Ihr! Kann man nur ein paar Monate lang im Jahr so essen!“ Zum Essen waren wir aber heute gar nicht da. Jedenfalls noch nicht. Wir waren ja zum Gartenkonzert hier.
„Wie Worpswede am Pazifik.“
Von Shelby Earl hatte ich zugegebenermaßen noch nie etwas gehört. Bandsintown schlug mir die Veranstaltung vor. So ist man auch in fremden Teilen der Erde über Konzerte in der Nähe informiert. Und fühlt sich wie ein Local. Hey hey. Wir hören Probe. Die Songs sind okay. So das Fazit. Kann man mal machen. Es geht ja auch eher um das kulturelle Event. Shelby Earl wirkt sympathisch. Auch wenn wir uns ein wenig wie Fremde auf einer Hochzeit vorkommen. Sie ist weiß gekleidet. Weiße Schuhe. Weiße Jeans. Weißer Blazer. Wir sitzen unter dem Dach eines bestuhlten Garten-Pavillons. Kies bedeckt den Boden. Das Gehen darauf macht immer so andächtige Knarzgeräusche. Im Teich quakt ein Frosch. Knarz. Quak. Knarz. Quak. Als beschwere er sich über die Gitarre. Das Singen. Über das Mikrofon-verstärkte Gequatsche. Oder über die vielen Menschen. Mit ihren Stimmen. Sonst hat er den Garten meist für sich. Heute nicht. Cambria ist ein Künstlerdorf. Wie Worpswede am Pazifik. Das Publikum ist dementsprechend. Älteres Semester. Freundlich. Das Leben bestanden. Shelby scherzt mit ihrem Stiefvater und ihrer Mutter. Sie sitzen in der ersten Reihe. Ihre Cousine ist auch da. Sie singt bei allen Songs laut mit. Dabei schaut sie durchs Publikum. Eigentlich wäre sie auch gerne Mittelpunkt des Abends. Singend. Gitarre spielend. Scherzend. Entertainend. Ist sie aber nicht. Ich gehe hinüber zur kleinen Bar. Provisorisch aufgebaut. Aber gut bestückt. Ich entscheide mich für ein eiskaltes Bier. Also eigentlich ist es ein Kölsch. Aus Kalifornien. Echt. California Kölsch. Knarz. Quak. Knarz. Quak.
Shelby erzählt eine Geschichte. Nach einer Show wurde sie mal von einer Frau angesprochen. Diese war begeistert vom Konzert. Kaum zu bremsen. Euphorisiert. Und ziemlich betrunken. Besonders angetan war sie von der Tatsache, dass sie und Shelby beide auf eine verflossene Liebe namens Jason zurückblickten. Jason. Jasoooooon. Singt die Frau. In Shelbys Augen erglühen Fragezeichen. Jason. Jasoooooon. Singt die Frau nochmal. Shelby achtet auf die Melodie. Und in verschwommenen Umrissen erkennt sie ihren eigenen Song. Wahrscheinlich hat jede Frau ihren Jason. Sagt die Frau. Und geht. Die Hände in die Luft streckend. Den Kopf in den Nacken wirbelnd. Hüften schwingend. Laut jauchzend. Benommen blickt Ihr Shelby hinterher. James! Der Song heißt James!
Wir fahren zurück zum Moonstone Beach Drive. Bevor ich mich unter die vielen Decken der amerikanischen Betten rolle, gehe ich noch einmal runter zum Strand. In schwarzer Nacht dem Ozeanrauschen lauschen. Gleich neben dem blühenden Busch, an dem am Morgen noch die Kolibris tranken.
Ich schalte die Nachttischlampe aus. Der Regen plätschert noch leicht auf die Autos, die im Innenhof des Motels stehen. Ein paar leise Stimmen plaudern irgendwo. Schritte. Keine Frösche. Ich höre den Pazifik. Denn der Pazifik ist immer da. Jedenfalls hier. In der stockfinsteren Lodge. Die grüne LED-Lampe flackert schwach. Die rote LED-Lampe blinkt. Wahrscheinlich ist die Festplatte voll. Oder die Batterien sind alle.
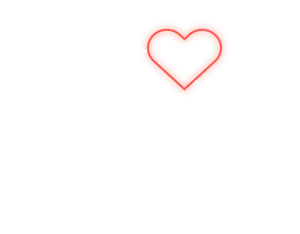
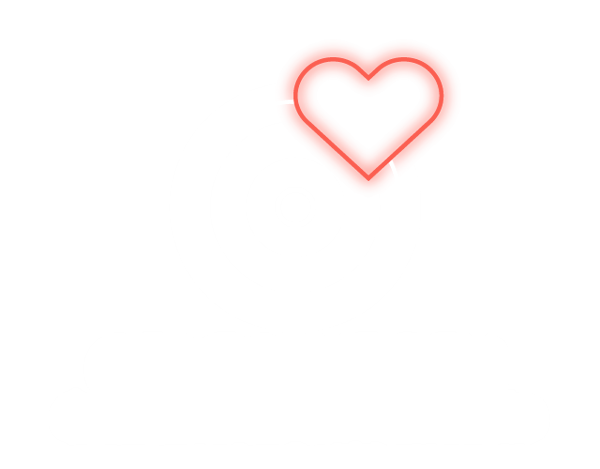






















Ja auch in Kalifornien kann mal Kackwetter sein, deswegen muss es aber nicht unbedingt schlechter sein. …cool geschrieben, auf jeden Fall 😀
Hallo Matthias, danke für die Blumen. Schönes Wochenende wünsche ich.